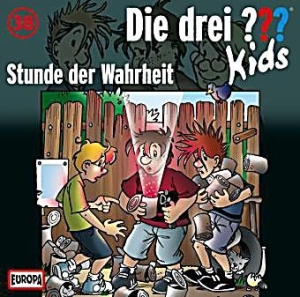Taube mit abgefaultem Fuß. Schuld sind die ausgelegten Fäden, in denen sich die Tiere verheddern und die die Gliedmaßen absterben lassen.
Foto: Initiative Stadttiere Braunschweig
Das Thema Stadttauben polarisiert wie kaum ein anderes. Auf der einen Seite Tierfreunde, die das Fütterungsverbot beklagen und die Tierquälerei durch Verletzungen verursachende Vergrämungsmaßnahmen anprangern. Auf der anderen Seite Immobilien- und Autobesitzer, die sich durch den Kot der Tiere gestört fühlen. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch immer mehr Krähen im Stadtgebiet beobachtet werden, die nachts unter ihren Schlafbäumen so einiges hinterlassen.
Fakt ist, dass sowohl Tauben als auch Krähenkot nicht nur Autolack und Häuserwände beschädigen kann, er birgt auch ein gewisses gesundheitliches Risiko. Die Ausscheidungen können Krankheitserreger wie Chlamydien und Pilze enthalten. Kommt man in Kontakt, lässt sich aber mit den üblichen Hygienemaßnahmen (Reinigung der Kleidung, gründliches Händewaschen, evtl. Desinfektion) die Gefahr weitestgehend minimieren.
In Sachen Taubenpopulation wähnt sich die Stadt Braunschweig auf einem guten Weg. Durch das Fütterungsverbot und die Vergrämungsmaßnahmen habe man die Anzahl der Tiere von Anfang der 90er Jahre um 90 Prozent verringern können. Lebten 1993 noch etwa 3.000 Tiere innerhalb der Okerumflut, seien es nun seit ein paar Jahren gleichbleibend etwa 300.
“Durch die nachhaltige Reduzierung des Bestandes, in erster Linie mithilfe der Durchsetzung des Fütterungsverbots und weniger durch technische Abwehr- systeme, sind die durch Taubenkot verursachten Schäden an städtischen Gebäuden mittlerweile relativ gering. Ganz kann auf entsprechende technische Schutzmaßnahmen aber nicht verzichtet werden,” so Rainer Keunecke von der Pressestelle der Stadt Braunschweig.
Beate Gries von der Initiative Stadttiere Braunschweig sieht die Sache angesichts vieler verstümmelter Taubenfüße, die auf die Vergrämungsmaßnahmen zurückgehen anders: “Es wird Zeit, dass auch die Braunschweiger Politik sich von dem Irrglauben verabschiedet, dass Stadttauben in der Feldflur leben könnten, wenn sie hier kein Futter finden. Als Felsenbrüter sind sie nicht in der Lage Nester in Bäumen zu bauen, wie ihre hier heimischen Verwandten, die Ringeltauben.
Egal wie aufwändig die Tiere ihr Futter suchen müssen und wie schmerzhaft und qualvoll ihre Verletzungen sind. Es ist ihre Natur, hier zu bleiben. Sie haben keine Wahl!“
Die Initiative Stadttiere fordert daher seit Jahren ein integriertes Stadttaubenmanagement, wie es in anderen Städten schon erfolgreich getestet wurde. Demnach werden den Tauben an mehreren Orten bewusst Futter und Nistplätze kontrolliert zur Verfügung gestellt. Die Tiere konzentrieren sich dann auf diese Plätze. “Dann wird auch die Stadt Braunschweig, was den Taubenkot angeht, eine saubere Stadt sein – ganz ohne öffentliche Tierquälerei”, ist sich Beate Gries sicher. Für ein Pilotprojekt, das die Initiative selber finanzieren würde, wird immer noch ein Hausbesitzer gesucht, der seinen Dachboden, sein Dach oder seine sonstigen Flächen bereitstellen würde.
Bei den Krähen – im Stadtgebiet von Braunschweig sind vor allem Saat- und Rabenkrähen verbreitet – ist die Sachlage eine andere. Im Gegensatz zur von der Haus-Brieftaube abstammenden Stadttaube sind Krähen Wildvögel und nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit der Europäischen Vogelschutzrichtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten besonders geschützt. Vergrämungsmaßnahmen sind daher nur in speziell begründeten Ausnahmefällen möglich. “Darüber hinaus wären Vergrämungsmaßnahmen bei Krähen dauerhaft kaum wirksam. Ein Rückschnitt der Bäume z. B. würde das Problem nicht grundlegend lösen, sondern allenfalls verlagern. Eine praktikable Lösung für die in der Regel punktuelle Verschmutzungsproblematik ist bisher nicht gefunden”, so die Stellungnahme der Stadt Braunschweig.
Die Ursache für das verstärkte Auftauchen der Krähen im Stadtgebiet ist laut Beate Gries hausgemacht. “Krähen, wie auch andere Wildtiere erobern unsere Städte. Der Grund dafür sind wir selbst: Wir grenzen ihren Lebensraum immer weiter ein durch Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bebauung.”